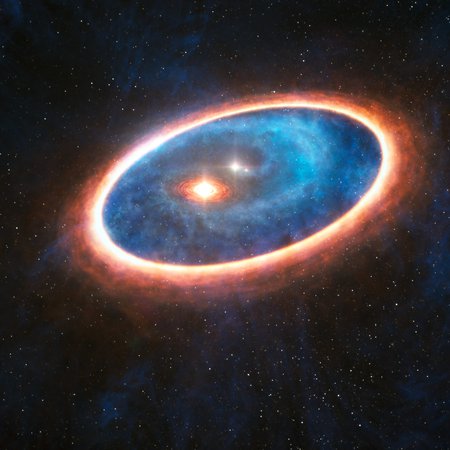Virtuelle Babelsberger Sternennacht am 20. Juni 2024 zum Meteoritenfund bei Ribbeck

Ein Bruchstück des Ribbeck-Meteoriten, der am 21. Januar 2024 in der Nähe von Nauen einschlug. Seine untypische hellgraue Farbe stammt von dem seltenen Material Aubrit.
Bild: Jürgen RendtelAm 21. Januar 2024 schlug ein Asteroid in Ribbeck bei Nauen in Brandenburg ein. Dr. Jürgen Rendtel vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) war einer der Meteoritensucher und fand selbst einige Bruchstücke. In seinem Vortrag, der ab Donnerstag, 20.06.2024 auf dem YouTube-Kanal „Urknall, Weltall und das Leben“ ausgestrahlt wird, berichtet er über die Entdeckung, die Suche nach den Fragmenten und die Besonderheiten des Meteoriten.
Asteroiden, kleine Gesteinsbrocken im Sonnensystem, kommen uns normalerweise nicht sehr nahe. Doch am 20. Januar 2024 wurde ein etwa ein Meter großes Exemplar entdeckt, das nur knapp drei Stunden später auf die Erdoberfläche traf. Beim Eintritt in die Atmosphäre leuchtete das Objekt als mondhelle Feuerkugel auf, die in der sternklaren Nacht weithin zu sehen war. Nach dem Ende der leuchtenden Bahn in rund 20 Kilometern Höhe gingen die Fragmente als Meteorite zu Boden. Beobachtungen der Feuerkugel durch Videokameras erlaubten eine genaue Berechnung des Fallortes, der sich westlich von Nauen in Ribbeck befand.
Sofort wurden Suchaktionen organisiert, um das frische Material schnell für Untersuchungen zu sichern. Ab dem 23. Januar wurden insgesamt mehr als 200 dokumentierte Fundstücke eingesammelt und untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass die Meteoriten aus dem überaus seltenen Material Aubrit bestehen. Der Meteoritentyp Aubrit ist benannt nach dem Fundort des ersten derartigen Stückes in Aubres, Frankreich, 1836. Der Kleinkörper stammt wahrscheinlich aus einem heißen Bereich unseres Sonnensystems und erlebte in seiner Geschichte viele Zusammenstöße mit anderen Gesteinsbrocken. So ist das Material sehr fragil; viele Stücke sind beim Aufprall zersplittert. Die Schmelzkruste ist glasartig und voller Blasen und muss sehr schnell erstarrt sein. Einzelne Meteoritenproben befinden sich noch in Laboren für Isotopenuntersuchungen. Dies ist erst das vierte Mal, dass Stücke eines zuvor als Asteroid beobachteten Objekts am Boden zu finden waren.
„Es ist ein großartiger Glückstreffer, dass der Asteroid mitten in Europa, sozusagen vor unserer Haustür, einschlug, und seine Bahn genau berechnet werden konnte“, sagt Dr. Jürgen Rendtel, Mitarbeiter der Abteilung Sonnenphysik, Experte für Meteoriten und erfolgreicher Finder mehrere Meteoritenstücke. Er erzählt in seinem Vortrag mit dem Titel „Von 2024BX1 nach Ribbeck“ von der Entdeckung des Asteroiden und der mühsamen Suche nach den Bruchstücken auf den Feldern bei Ribbeck. Dabei geht er auch auf die besonderen Eigenschaften des Materials ein. Eine Zusammenfassung der Meteoritensuche und bisherigen Ergebnisse erscheint am 26.06.2024 in einem Artikel von Jürgen Rendtel und Koautoren in der Zeitschrift WGN, The Journal of the International Meteor Organization.
In der Regel jeweils am 3. Donnerstag des Monats ab 20 Uhr sind die Vorträge der Babelsberger Sternennächte unter
https://www.aip.de/babelsberger-sternennaechte
bzw. über den YouTube-Kanal Urknall, Weltall und das Leben und videowissen verfügbar und können im Anschluss jederzeit abgerufen werden.
Weitere Informationen
Babelsberger Sternennächte: https://www.aip.de/babelsberger-sternennaechte
Eintrag in der Meteoriten-Datenbank: https://www.lpi.usra.edu/meteor/?code=81447
Bilder
Ein Bruchstück des Ribbeck-Meteoriten, der am 21. Januar 2024 in der Nähe von Nauen einschlug. Seine untypische hellgraue Farbe stammt von dem seltenen Material Aubrit.
Große Bildschirmgröße [1000 x 684, 160 KB]
Originalgröße [3918 x 2682, 2.0 MB]
Das Meteoritenstück an seinem Fundort auf einem Feld in Ribbeck.
Große Bildschirmgröße [1000 x 1243, 270 KB]
Originalgröße [1665 x 2071, 710 KB]